 |
Die Aggregatzustände
Es ist allgemein bekannt, dass die Materie aus Atomen oder Molekülen aufgebaut
ist. Die Stoffe können jedoch in unterschiedlichen Erscheinungsformen vorliegen.
Denken wir beispielsweise an Wasser, das immer aus H2O-Molekülen
besteht. Hier gibt es eine feste (Eis), eine flüssige (Wasser) und eine
gasförmige Phase (Wasserdampf). Man bezeichnet dies auch
als den festen, den flüssigen und den gasförmigen Aggregatzustand.
Die Ursache hierfür ist in der Wechselwirkung der Bausteine der Materie,
also der Moleküle bzw. Atome, untereinander zu suchen: Diese befinden sich
in ständiger unregelmäßiger Bewegung, deren Intensität
von der Temperatur abhängt. Diese wird daher auch thermische Bewegung
genannt. Ein deutliches Indiz für die thermische Bewegung der Moleküle
ist die Brownsche Molekularbewegung.
Wir werden hierauf später genauer eingehen.
Zwischen den Molekülen eines Stoffes wirken andererseits anziehende Kräfte,
die als Bindungskräfte oder Molekularkräfte bezeichnet werden. Die
thermische Bewegung wirkt den Bindungskräften entgegen. Abhängig vom
Verhältnis von Bindungsenergie zu thermischer Energie finden wir die unterschiedlichen
Erscheinungsformen der Materie: Wir unterscheiden den festen,
den flüssigen und den gasförmigen
Aggregatzustand. Jeder der drei Aggregatzustände hat eine besondere innere
Struktur, die seine Eigenschaften wesentlich bestimmt.
Ändert sich die Intensität der thermischen Bewegung der Moleküle
eines Stoffes, so ändert sich auch das Verhältnis zwischen Bindungsenergie
und thermischer Energie. Als Folge kann ein Stoff seinen Aggregatzustand ändern.
Man bezeichnet dies als Phasenübergang.

|
 |
Phasenübergänge
Im festen Körper schwingen alle Atome um ihre Gleichgewichtslagen im Kristallgitter.
Wird nun die thermische Energie erhöht, so werden die Schwingungen immer
stärker bis schließlich die Schmelztemperatur erreicht ist. Wird
jetzt weiterhin Energie zugeführt, so wird diese zum Aufbrechen der Kristallbindungen
verwendet: Der regelmäßige Aufbau des Kristallgitters wird zerstört,
der Körper schmilzt und wird zur Flüssigkeit. Während dieses
Prozesses bleibt die Temperatur konstant. Man nennt dies einen Phasenübergang.
Jeder kennt die Phasenübergänge des Wassers aus dem Alltag: Wenn
wir festes Eis erwärmen, so schmilzt es und wird zu flüssigem Wasser.
Dies ist der Phasenübergang fest-flüssig. Erhitzen wir das Wasser
weiter, verdampft es schließlich und wir erhalten als Resultat des Phasenübergangs
flüssig-gasförmig den gasförmigen Wasserdampf. Weniger bekannt
ist, dass Eis sich auch direkt in den gasförmigen Zustand umwandeln kann.
Diese als Sublimation bezeichnete Phasenumwandlung kann aber z. B. an trockenen
Wintertagen häufig beobachtet werden.
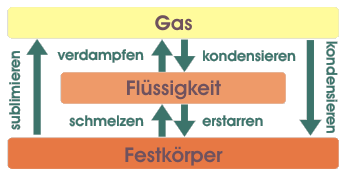
Mögliche
Phasenübergänge
Natürlich kann man den Prozess auch umkehren: Wasserdampf kann zu Wasser
kondensieren das wiederum zu Eis erstarren kann. In der Graphik sind alle möglichen
Phasenübergänge zusammengefasst. Sie gelten natürlich nicht nur
für Wasser, sondern genauso für jeden anderen Stoff.
Anmerkung: Phasenübergänge werden ausführlich
der SLE "Phasenübergänge" behandelt.
|
|



